
|

|

|

|
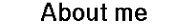
|
In Helvetios 14.-17.06.1990

Inhalt
Donnerstag, der 14.06.1990
Nicht lange nach 5.00 Uhr früh, zu nachtschlafener Zeit also, hatten wir uns getroffen, "besammelt", wie man in der Schwyz zu sagen pflegt, hatten im strömenden Regen unsere Rucksäcke, Zelte und Kocher verladen, und waren in unseren beiden Ford Transit - Bussen unter tiefhängenden Wolken geflohen, Richtung Süden, wo ein Genua - Tief mit andrängenden Hochdruckmassen seit Tagen in unentschieden hin- und herwogendem Kampf lag. Noch vor der Grenze in Basel stellten die 16 Expeditionsteilnehmer dan befriedigt fest, das es immerhin schon nicht mehr regnete. Unsere Voraussicht, früh abfahrend den Konkurrenten des Feiertagsverkehrs auf der Autobahn zuvorzukommen, hatte sich ausgezahlt, und so verliessen wir in aufgeräumter Stimmung kurz hinter Basel die Autobahn, folgten den Hinweisschildern mit der weißen Säule auf braunem Grund ein kurzes Stück parallel zum nicht sichtbaren Rhein, während sich rechts der Straße Felder und Industrieanlagen abwechselten, und gelangten rasch zu unserem ersten Ziel, nach Augusta Raurica. Bis zur Öffnung des Museums im Römerhaus hatten wir nun noch mehr als eine Stunde Zeit, die wir zu einem Rundgang durch die Ausgrabungen nutzten. Der Tempel auf dem Schönbühl bot einen ersten Überblick über die räumliche Zuordnung der konservierten Reste: zur Linken das Römerhaus, direkt unterhalb des Schönbühlhügels die römische Backstube, aus der feiner Rauch von Holzfeuer zu uns emporstieg, vis-à-vis das verwirrende Ensemble aus Theater- und Amphitheatermauern, unmittelbar dahinter das Hauptforum, Basilica, Curia, dahinter Thermen, Töpfereien, Ziegelöfen (ein zu Demonstrationszwecken neu errichteter übrigens direkt unterhalb der Curia!), zur Rechten des Schönbühls Septizonium und Amphitheater, die Tempelbezirke von Grienmatt und Sichelen und die Reste der Mansio. Fundamente, Mauern, Gebäudereste: gut und schön. Am meisten Eindruck aber hinterließen zwei handwerkliche Einrichtungen: im Holzhaus auf dem Gelände des Forums, in dem früher die römische Wasserversorgung dokumentiert und Funde von Resten der Wasserleitung ausgestellt waren, befindet sich neuerdings eine Ausstellung zur terra sigillata. Vor allem aber gibt es hier die Möglichkeit, selbst ein terra - sigillata - Gefäß aus bereitliegendem, feuchtgehaltenem Ton auf einer Töpferdrehscheibe zu drehen und gegen 30 sFr. von Museumsangehörigen in jenem oben erwähnten Brennofen brennen zu lassen. Das Erzeugnis bekommt man dann zugesandt.Und eben die römische Backstube, in der eine Klasse Schweizer Sechstklässler dabei war, ihr eigens Brot herzustellen. Wir beobachteten sie dabei,während wir selbst unsere beim Bäcker gekauften, von Muttern geschmierten Frühstücksstullen heruntermümmelten. Sie gingen arbeitsteilig vor: einige mahlten auf einer kleineren Handmühle, andere auf der größeren, ebenfalls aus zwei gegeneinanderlaufenden sorgfältig bearbeiteten Mahlsteinen bestehenden Getreidemühle die mitgebrachten Getreidekörner zu Mehl, eine dritte Gruppe sammelte das Mehlpulver, schüttete es in eine -nun ja, Plastikschüssel, vermengte es mit Wasser, fügte Honig und Hefe dazu, und zehn fleißige Bäckerhände griffen und knoteten und kneteten um die Wette. Währenddessen brannten im runden Ofen schon die Holzscheite lichterloh. Nach erreichen der erforderlichen Temperatur würde die Glut herausgekratzt werden und man würde die Brotlaibe auf den heißen Steinen des Ofens backen lassen. Generationen von kleinen Bäckern hatten dafür gesorgt, daß Wände und Decke rauchgeschwärzt waren. Nicht mehr lange würden heute die Schieber in der Ecke auf ihren Einsatz warten müssen, mit dene das Brot in den heißen Bauch des Ofens hineinbugsiert würde. Mit einem Seitenblick auf den links vom Eingang der Backstube aufgemauerten Rest einer römischen Wasserleitung wollten wir uns rasch auf das Museum zubewegen, aber die Römer ließen uns nicht. Einige Zeit rätselten wir an den Angaben der Legende zum Gefälle der Wasserleitung herum, fragten uns, wieviel denn 2 promille Gefälle sei, gerieten fast in Streit darüber, ob das nun zwei Grad seien oder Fuß oder Meilen; zum Glück behielt ein Mathematiker seinen kühlen Kopf und erklärte uns die schier unglaubliche Leistung der römischen Architekten, der Wasserleitung auf 1000m nur 2m Gefälle zu geben. Dann wieder entzweite uns die Frage, woraus denn die wasserdichte Auskleidung der Innenwände jener Wasserleitung bestanden habe, denn der Ausdruck Estrich erklärt ja nichts.
Inzwischen war es weit nach 10.00 Uhr geworden, und als wir ins Museum kamen, flogen uns aus allen Winkeln des Römerhauses Wortfetzen und Satzfragmente um die Ohren, auf Französisch, in Schwyzerdütsch, und manchmal auch in unerfindlichen Dialekten. Im Triclinium mutmaßten einige, wie man sich wohl beim Gelage gebettet habe und ob man es so, auf der Seite liegend, wohl lange habe aushalten können. Ein Lehrer aus dem Elsaß erklärte die Hypocausten, und vierzehn Augenpaare richteten sich abwechselnd auf ihn und auf die Tonpfeilerchen. Im Apodyterium konnten natürlich unsere Burschen die Hände von der wunderschönen Statue der nackten Aphrodite nicht lassen, deren speckigere Körperpartien sofort verrieten, wo die Vorlieben der Besucher lagen.
Es ist schwer, eines der überraschend zahlreichen muslimischen Mädchen der Klasse aus dem Elsaß, die mit ihren Kopftüchern und ihren wunderbar ebenmäßigen Gesichtern sofort ins Auge fallen, zu fotografieren, während es neben der Statue der Aphrodite sitzt. Ich finde den Gegensatz atemberaubend und frage mich, was wohl in diesen Mädchen vorgehen mag angesichts dieser lasziven Nacktheit, angesichts unserer respektlos tatschenden Jungen.
Im Peristyl des in mittelmeerischer Pracht erblühenden Gartens liegt eine Kleine vor dem Larenaltar am Boden und kopiert sich akribisch in großen Buchstaben die Inschrift. Unsere Schüler sind beeindruckt von den ausgestellten Rekonstruktionen: römische Nagelschuhe verschiedener Konfektion; eine Räucherkammer; ein Wandregal für Amphoren; die Verkaufstheke eines Thermopolium; das als einfach gekennzeichnete Modell eines Türriegels, dessen Geheimnis dann doch bleiben wird, wie man den Schlüssel abziehen kann, wenn man im Haus ist. Eine Fülle großartiger Kleinfunde rundet die Ausstellung ab.
Als wir nun doch, nach fast 1½ Stunden, die wie im Fluge vergangen sind, vor die Tür treten, blendet uns die Sonne. Wir essen noch schnell unter dem Vordach einen Apfel, der eine oder andere nuckelt eine Zigarette, mit vorüberkommenden Italienern verständigen wir uns über die WM - Chancen, dann brausen wir unaufhaltsam weiter über die N2, Richtung Lausanne. Wir haben noch viel vor heute, bleiben deshalb auf der Autobahn und sehen daher den Lacus Lemanus, den Genfer See, nur aus der Vogelperspektive. In Villeneuve erst zwingt uns die Trasse in die Ebene, jetzt sind wir auf gleicher Höhe mit dem Rhodanus, der Rhone, uns aus dem Caesar zur Genüge bekannt. An Aigle fliegen wir vorbei, lassen St. Maurice hinter uns, achten aber sorgfältig darauf, die Autobahn vor Martigny zu verlassen, um uns ein Naturwunder anzusehen, dan dem man nur allzu leicht vorüberfährt: die Gorges du Trient, einen mehrere hundert Meter langen und teilweise nur 6 Meter breiten Spalt, den sich der aus dem Trientgletscher austretende Bach in Jahrtausenden in die lotrecht mehr als 200m emporschießenden Felswände gesägt hat. Legt man den Kopf in den Nacken, trifft einen im tosenden Halbdunkel der Klamm unvermittelt die geballte Wucht der Sonnenstrahlen - und dann glaubt man seinen Augen nicht zu trauen: da haben diese verrückten Schwyzer doch tatsächlich in schwindelnder Höhe eine ganz schlanke, ganz fragile Brücke über diese Schlucht gelegt. Schon jetzt wundern wir uns über den schlagartigen Wechsel von gleißender Helle und tiefem Dunkel in der Schlucht, über stillstehende, hellgrüne ruhende Tümpelchen, während nebenan der Bach tobt, über das weiche Wasser, das den harten, rauhen Stein so glatt poliert hat.
Dann aber sind wir endlich in Martigny (Octodorum oder Forum Claudii Vallensium), der Stadt am Rhoneknie, da wo die Straßen aus dem Genferseegebiet, aus Gallien und aus dem Oberwallis zusammenlaufen, um über den Großen St. Bernhard, den Summus Poeninus, nach Aosta (Augusta Praetoria) und weiter nach Turin (Augusta Taurinorum) zu führen. 57 v.Chr. von Galba zur Überwinterung der 12. Legion benutzt (cf. Caesar, bellum Gallicum III 1-6), wurde der Ort ca. 47 n.Chr. von Kaiser Claudius gegründet.
An diesem sommerlich-südlich heißen Spätnachmittag begnügen wir uns mit einem Besuch der Fondation Pierre Giannada. Hier ist, auf den Grundmauern der sogenannten Temenos - Thermen, das Musée archéologique gallo - romain artriumartig in zwei Stockwerken um die Reste eines gallorömischen Tempels herum im Jahre 1976 angelegt worden. Im ersten Stock präsentiert sich die Archäologische Sammlung, während das Erdgeschoß jedes Jahr über mehrere Monate hinweg moderne Künstler ausstellt. Mit großer Enttäuschung mußten wir erfahren, daß eine Modigliani - Ausstellung erst am 19.06. eröffnet werde, während wir am 17.06. bereits würden heimfahren müssen.
Entschädigen mußte uns da die Ausstellung von Oldtimern der höchsten In einer Nahegelegenen Tiefgarage mit Tunnel zum Museum. Zum Spottpreis von 60.000 sFr. stand da ein Bugatti, fahrbereit, zum Mitnehmen. So ein Schnäppchen! "Aber die Ersatzteile!" hörte ich neben mir einen Schweizer seiner Frau erklären, "Gopferstutz!"
Als wir ins Museum zurückkehrten, hier eine kleine Aphrodite von Knidos, gearbeitet nach Praxiteles, dort einen kleinen Bronzeapollon bewunderten, dessen weiche Körperformen in uns den Verdacht auf Bisexualität nährten, hatten andere die halb ausgepackt an der Wand lehnenden Bilder von Modigliani entdeckt. Man stelle sich vor: einer dieser liegenden Akte in Rot, geschützt von groben Holzrahmen, von Packpapieren umhüllt - enthüllt: welche Dopplung des Motivs!
Dann aber haben wir, nach einem Abschiedsblick auf ein riesiges Dia von der römischen Straße, die in die Felsen auf der Paßhöhe des Großen St. Bernhard eingekerbt ist, das Museum durchschritten, treten hinaus in den hell überfluteten Garten, in dem heute alles üppig ist: die vielen Grüntöne vor den Füßen und soweit ringsum an den Hängen hinauf der Blick reicht; Fernando Boteros atemberaubende frauenstatuen, die unsere zierlichen Mädchen sichtlich einschüchtern; Henry Moore's "Mutter mit Kind"; Dubuffets rätselhafte Wand; Brancusi, Arp, Rodin - und dann setzensie sich neben eine Gipsfrau von Segal auf die Bank. Wir fühlen uns wie im Paradies, alles um uns herum ist fruchtbar, berstend vor Kraftund Lust, und um das maß vollzumachen, steht da ein Korb mit süßen Kirschen, auf Französich darum bittend, man möge sich ungeniert bedienen. Eigentlich wollen wir gar nicht weg hier, möchten gleich hier, zwischen Kunst und Natur eingebettet, eingehüllt, selbstverständlich und sicher, unsere Zelte aufschlagen und im Licht der Sterne uns im geheimen Zauber dieses Ortes wiegen.
Trotzdem entreißen wir uns, schon etwas gewaltsam, dem Flair dieses spätnachmittaglichen Glücks und fahren über Orsières noch an diesem Abend nach Praz de Fort, schrauben uns, der Auskunft einer britischen Touristin vertrauend, noch unzählige Serpentinen ins Gebirge hinein. Der Weg ist so steil, daß wir nur im ersten Gang vorankommen, einmal pack es der Wagen gar nicht mehr, da hilft nur noch Aussteigen, Anschieben. Als es zu dämmern beginnt, haben wir das Ende dieser Straße erreicht, unterhalb einer Stauanlage für den Bach, der nur 500m weiter oberhalb aus dem Gletschertor des Saleinagletschers austritt. An den Baubuden der Arbeiter finden wir einen ebenen Platz, der es uns erlaubt, alle Zelte nebeneinander aufzuschlagen. Lange beschäftigt uns das Gewirr von Planen, Leinen, Heringen. Hämmer wechseln von Hand zu Hand. Matratzen und Schlafsäcke werden ausgerollt. Das Heim für die Nacht steht. Langsam und friedlich senkt sich samten und blauschwarz der Abend auf uns herab, und mit dem Surren der Gaskocher erscheinen die Sterne, wir wissen nicht wie: sie sind immer da und erscheinen doch! Wir sind müde heute: seit 4.00 Uhr auf den Beinen, und jetzt ist es nach 23.00 Uhr. Gesehen haben wir für Wochen; wer wollte auch nur annähernd alle Eindrücke festhalten. Und das war erst der erste von vier Tagen!
Mit Klaus bespreche ich noch den Ablauf des nächsten Tages. Wir werden von unserem Zeltplatz auf schätzungsweise 1500m Höhe zur Saleina - Hütte aufsteigen; das sind zwar nur 1200 Höhenmeter,aber wir kennen den Weg nur von der Schweizer Landkarte her. Zwar habe ich noch kurz vorm Dunkelwerden die erste Dreiviertelstunde bis zu einer Felskanzel oberhalb des Gletschers erkundet; wie's darüber aber weitergeht, weiß niemand. Mindestens das ist sicher: der Weg ist begangen, bezeichnet und er ist für unsere Mannschaft zu packen.
Es ist eine gemischte Gruppe, die sich hier zusammengefunden hat, verschiedene Altersgruppen, Jungen und Mädchen, Ängstlichere und Forschere, gute Schüler und schulische Sorgenkinder, aber alle mit einer Frische und Offenheit fürs Abenteuer, die mich mit großer Sympathie für sie erfüllt.
Klaus schläft schon. Ich kenne seine ruhigen Atemzüge. Im Oktober lagen wir zuletzt in diesem Zelt, unter der Tofana di Rozes in den Ampezzaner Dolomiten. Wir hatten die lange Fahrt über Bruneck, durchs Puster- und dann durchs Gadertal, über den Valparolepaß, am Hexenstein vorbei, über den Falzarego mit seinen traurigen Mahnmalen des Ersten Weltkriegs auf uns genommen, um um noch einmal in die glühenden Farben des Herbstes im Gebirge zu tauchen, um noch einmal den nadelspitzen, in die Augen gleißenden Kalkfels unter unseren Händen zu spüren, bevor der Winter kam und der Alltag, die unsere Seelen austrockneten, würgten, aber doch - das wußten wir genau - nicht würden gänzlich ersticken können. 10 Jahre war es jetzt her, daß wir zuerst in die Berge gingen; damals, 1980, war ich noch Lehrer in Heilbronn, da war er in der 10. Klasse - so wie die anderen jetzt, 1990. Und jetzt war Klaus der Führer. Ein Generationenwechsel hatte stattgefunden. Mit Befriedigung stelle ich fest, welche Bande solche Unternehmungen knüpfen, die uns in Handlungszusammenhänge führen, die uns in allem ansprechen, herausfordern, fördern, indem sie uns unstrukturiert die Möglichkeit geben, unsere Tauglichkeit, unsere  zu prüfen, festzustellen, wo und wie sehr wir uns auf uns selbst verlassen können. Das ist ganz elementar, das beginnt beim Körper.
zu prüfen, festzustellen, wo und wie sehr wir uns auf uns selbst verlassen können. Das ist ganz elementar, das beginnt beim Körper.
Freitag, der 15.06.1990
Am nächsten morgen müssen wir die Schlüsselstelle des Hüttenanstiegs schon ¾ Stunden nach dem Abmarsch bewältigen: ein Felsriegel oberhalb der Moräne sperrt den Weiterweg. In die Platten sind zwar Griffe und Tritte eingekerbt, man hat aber zur Sicherheit auch noch Ketten eingehängt, denn bei feuchtem Wetter oder gar Vereisung böten diese Passagen ernste Schwierigkeiten. Und hier schon beim Aufstieg, mehr noch beim Abstieg am darauffolgenden Tag, kommt neben der Anstrengung auch die Angst hervor, die Ungewißheit "halten mich die eigenen Arme oder nicht? Was ist, wenn ich abrutsche?" Ich gehe als letzter und kann so versuchen - nein nicht zu helfen (außer in akuter Not natürlich), sondern dabeizusein, nur durch meine geduldige, uneilige Anwesenheit die Möglichkeit zu bieten, daß sie Vertrauen entwickeln können zu ihren Kräften, Sinnen, Fähigkeite. Ich bin selbst überrascht, wie elementar hier Defizite sein können, und, andererseits, wie durch deren Überwindung sich eine solide, verläßliche Basis des Selbstvertrauens auch in anderen Situationen auf die Dauer herausbilden kann.
Schon lange habe ich die Überzeugung gewonnen, daß unsere verbale Belehrung und hypertrophe intellektuelle Beanspruchung diese Schüler verfehlen, indem das Wissen sinnlos - bewußtlos erworben wird, auf Vorrat erworben oberflächlich und angeklatscht bleibt, zugleich aber der Körper total ausgeblendet, sistiert, kaserniert wird und die Emotion und die Gefühle von den meisten Unterrichtsgegenständen und -methoden nicht tangiert werden, ja oft genug der Eindruck entsteht, die Schüler brächten ihre Emotionen vor der unterrichtlichen "Behandlung" in Sicherheit, um den kostbarsten Teil ihres Ich zu bewahren.
Das aber schlägt auf den Unterrichtenden zurück. Auch er wird auf die Dauer gezwungen, sich so abstrakt - abstinent - neutral zu verhalten, mindestens für die Zeit des Unterrichts und für die Sphäre der Schule. Diese Zeiten aber sind Lebenszeit, die unumkehrbar, nicht zurückholbar zerrinnt. Ich aber kann nicht länger mitansehen, einsehen, für gut halten, billigen, geschehenlassen, ja mitmachen, daß ich mich selbst und andere auf die beschriebene Weise verstümmele.
Neben den emotionalen Defiziten ermangelt jener Landläufige Unterricht auch der Herausbildung von Handlungskompetenz und Verantwortlichkeit bei den Schülern. Einfaches, eindimensionales Lernen bleibt folgenlos, wenn nicht das Handeln als seine zwingende Fortführung und als Methode des Erkenntnisgewinns hinzutritt.
Vielleicht ist es ja auch schwer bis unmöglich, im kognitiven Bereich solche Handlungsanreize zu setzen wie beispielsweise im haptisch- motorischen. Wie sonst ist es erklärbar, daß unsere Jugendlichen an einem steilen Felsabbruch, der von den lokalen Kletterern als Boulderwand zum Trainieren benutzt wird, herumklettern und einums andere mal versuchen, Quergänge durchzuhalten oder bis zu einem Haken emporzuklettern, zehnmal, fünfzehnmal, dieselben Jugendlichen, die in der Schule bei Lateinübersetzungen sehr viel schneller aufgeben, weil sie es angeblich "nicht konnten", ja die es teilweise erst gar nicht versuchten.
Meine Hoffnung - es hieße, den Mund zu voll zu nehmen, von einem "Ansantz" zu sprechen - liegt darin, über das frühzeitige und mehrfache Erleben und Durchleben solch elementarer und ganzheitlicher Situationen den Jugendlichen den Spielraum zu eröffnen, sich als Person kennenzulernen, sich handelnd in der Gruppe objectiven Problemen zu stellen (insofern ist der Spielraum auch schon ein Ernstfall und keine folgenlose Laborsituation!) und nach und nach zutrauen zu sich zu gewinnen und die so gemachten elementaren Erfahrungen zu übertragen auf kognitive und komplexere Situationen und Anforderungen. Anders ausgedrückt: ich rechne ganz entschieden mit einem Transfer der in stark körperbezogenen und wesentlich emotional geprägten Handlungssituationen gewonnenen Erfahrungen auf komplexere und durchaus andersartige Situationen des menschlichen Lebens.
Um nur ein Beispiel zu bringen: wo lernt man besser Frustrationstoleranz als beim gehen im Gebirge? Wo ich mir die Situation ausgesucht habe, wo ich die Bedingungen bedenken kann oder auch nicht, wo aber die Bedingungen objektiver Art eben nicht meinem Willen unterliegen und auch nicht von der Stimmung, dem Wohl- oder Übelwollen des Berges abhängen. So verlaufen sich die Anklagen gegen äußere Einflüsse, die willentlich gegen mich sind, und ich lerne, mich zu konzentrieren auf die Bewältigung der sich stellenden Probleme. Und die so gemachten und am besten wiederholt gemachten Erfahrungen inkorporiert, werden zu Reflexen, zu inneren Gewißheiten und verdichten sich zu Selbstbewußtsein, zum Wissen, daß ich mich auf mich selbst verlassen kann, und das wiederum setzt die Angst davor, allein zu sein, verlassen, auf "nur" sich selbst angewiesen - und damit verloren, deutlich herab.
Elementare Erfahrungen und Gefühle fehlen so sehr im modernen Lebenszusammenhang, daß die Surrogate gerade im großstädtischen Leben immer stärker gesucht werden. Oben in der Höhe ist, für die kurze Zeit des Aufenthalts dort, das Leben einfacher, überschaubarer, begreiflicher. Da wird es Freude, sich im Schneefeld vor der Hütte zu suhlen, seinen nakten Körper mit der Natur zu vereinigen. Oder beim Holzhacken, dem weder Haublock noch der Schaft der Axt, wohl aber das zu zerspaltende Hartholz standhielt.
Samstag, der 16.06.1990
Und dann nachts vor dem Zelt, das Feuer: als müßten sie Savonarola und Bruno gleichzeitig verbrennen, raffen sie, türmen sie halbe Bäume aufeinander. Und als wären Hunderttausende von Jahren menschlicher Evolution spurlos an ihnen vorübergegangen, ist ihnen ein Feuer immer noch tremendum und fascinosum.
Natürlich sind diese Erlebnisse in der Intensität nur verstehbar vor dem Hintergrund der Entleerung des Alltags von Ritualen und von elementaren Akten. Trotzdem halte ich es für sinnvoll und notwendig, jedes Jahr solche Dinge, solche Konfrontationen zwischen mir und der Natur herbeizuführen bis zu jener Grenze und über jene Grenze hinaus,da das Zittern und die Ungewißheit anfängt, halte es für eine Priorität meines Lebens, das selbst zu erleben und den Jüngeren erlebbar zu machen.
Samstag, von der Saleina- Hütte wieder herabgestiegen, klettern wir einen halben Tag lang, schauen einem alten Mann zu, der erst letztes Jahr begonnen hat zu klettern und der nun, von einem Bergführer gesichert, kurze Passagen des 5. und 6. Schwierigkeitsgrades überwindet, bewundern die zwei jungen Walliser Pärchen, erleben, wie Schönheit und Eleganz der Körperbewegungen sich mit Kraft und Entschlossenheit paaren, wie das Licht der Abendsonne die Muskeln unter der sonnengegerbten Haut vieler solcher Abende plastisch herausmeißelt, sehen jetzt schärfer und kontrastreicher die Kanten, Risse, selbst die winzigsten Fingerleisten im Fels - und werden traurig im Gedanken an die blassen, glatten und nichtssagenden Wände unseres modernen Zweckbaus, an die Not, in Raucherecken herumstehen, in Discoraum oder Mensa unsere freie Zeit vertrödeln zu müssen; irgendwie fühlen wir uns durch diese Architektur unterschätzt, degradiert, als sollten wir durch sie auf degeneration festgeschrieben werden.
Im Gegenlicht sehe ich, wie einige von uns in hellgrünen Badewannen aus eisigem Gletscherwasser das nimmermüde, ewiglockende Bächlein überihre Glieder rinnen lassen, und ich erkenne die unbezähmbare Kraft des Wassers wieder, an de runden Felsblöcken, die mir die Frauenkörper Boteros heraufbeschwören, und ich hebe mir zwei Kinder dieser Felsen in den Rucksack, um mich dieser Eindrücke zu versichern, wenn ich am Montag wieder an diesem Schreibtisch sitzen werde, Bleistifte stemmend vor glatter Resopalplatte, mit diesen Fingern, an denen zwei Tage zuvor noch mein Leben hing. Wie gut, das zu wissen!
Sonntag, der 17.06.1990
Blutenden Herzens verlassen wir am Sonntag morgen den Gastlichen Platz oberhalb von Praz de Fort, gleiten zurück ins Tal, nein, an der Abzweigung nach Orsières nicht nach rechts, nicht hinauf zum Summus Poeninus, nein, dem Blick zum Grand Combin und zum Mont Blanc werden wir uns nicht aussetzen, nein, hinterm Paß werden wir nicht nach Aosta hinunter und nicht ins Val de Cogne hinauf in den Naturschutzpark des Gran Paradiso fahren, diesmal nicht, - und doch erscheint uns nichts konsequenter als dies, führt uns das Herz zu nichts anderem und schon gar nicht in die Schule zurück. Nie schien mir evidenter, wie absurd das Ritual von Schule ist - mit dem ich doch mein Geld verdiene! Wir aber gehorchen für diesmal dem Ritual und biegen nach links ab. Mir geht ein Gedicht durch den Kopf, es ist lange her, daß ich es einmal hörte, 1972 in Freiburg, in einer anglistischen Vorlesung, und jetzt, da ich an dieser Kreuzung stehe, fäällt es mir wieder ein; es ist von Robert FROST: The road not taken.
Chillon
Als seien die Dents du Midi in den See gestürzt mit all ihren Graten und Türmen, so kompakt, klobig, trotzig und schroff liegt das Schloß uns gegenüber - und welche zarten Winkel im Inneren! An jenem Fenster zu sitzen, der Geliebten ins Angesicht, während der See hereinschaut: "Ille mi par esse deo videtur..." ("Jener scheint mir einem Gotte gleich zu sein...": Catull).Ich steige bis zum höchsten Punkt, Dachböden, Stiegen überwindend. Merkwürdige Gedanken gehen durch mich hindurch: hier oben eine Woche sitzen, auf den See hinausschauen, ein Buch lesen, eines von den vielen auf meiner inneren Liste. Vielleicht "I promessi sposi" ("Die Verlobten") von Manzoni. Scon im Kellerverließ, aus dem gewachsenen Felsen gehauen, ja, da wo Bryon einige Zeit eingekerkert war, da wo der See Dir ganz schaurig nah ist, durch den vergitterten Ausgang hindurchschauend, den Wolken nachsehend, Shelley`s "Ode to the west wind" von 1819/20, von der ich Fragmente unhörbar den Lüften anvertraue:
O wild west wind, thou breath of autom's being, ... wild spirit, which art moving everywhere, destroyer and preserver... angels of rain and lightning... black rain, and fire, and hail will burst: oh, hear!... If I were a dead leaf thou mightest bear; if I were a swift cloud to fly with thee... Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud! I fall upon the thorns of life! I bleed! A heavy weight of hours has chained and bowed One too like thee: tameless, and swift, and proud... O, wind, if winter comes, can spring be far behind?Und, allein, an einem jener sehnsuchtstrunkenen Fenster übern See hin: Leopardi: Das Unendliche.
Am unwahrscheinlichsten aber erscheint mir nun Literatur, Dichtung in der Schule. Wie gesund ist da die Reaktion der Schüler, wenn sie sich zurückziehen, das ist mir Sonnenklar. Und doch beklag ich's als Lehrer. Wie aus dem Dilemma herauskommen?
14.00 Uhr, in einer Stunde spätestens müssen wir zurück. Draußen, die Dichtung und der Zauber des Schlosses liegen hinter mir in der flirrenden Hitze der Mittagssonne, draußen tobt das Leben. Die kehligen Stimmen einer Gruppe von Südländern dringen an unser Ohr, mir sind sie die willkommenste Musik, mich von der Schwermut Leopardis zu befreien. Klaus und ich können uns nicht einigen, woher sie kommen. Schließlich entscheide ich: Spanisch. Tatsächlich sind sie aus Mexico; seit 9 Monaten sind sie in der Schweiz, lernen Sprachen, studieren; ihre Schwangerschaft nähert sich dem Ende: in ein paar Tagen fliegen sie zurück, es ist ihr letztes Wochenende hier. Die verschwenderisch- üppige Natur des Südens schlägt mich: mein Gott, wer möchte noch Bücher lesen, wenn er stattdessen mit diesen lebensprallen, lebenstrunkenen Menschen zusammensein könnte! Die unendlichen, labyrintischen riccioli neri der Mädchen - und, o Wunder der Natur, die ganz unglaublich roten Locken! Wir wechseln ein paar Worte auf Italienisch. Wie leicht das ist, Leute kennenzulernen. Und wie schwer, sie wieder gehen zu lassen!
In Heidelberg wissen wir: wir sind nur zurückgekehrt zu neuem Aufbruch!
Michael Stimpel