
|

|

|

|
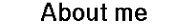
|
Auf Hannibals Spuren über die Alpen 1989

Es war auf der Écrins-Hütte im Haute-Dauphiné gewesen, ein schneeverhangener Juliabend, keine Chance, morgen auf die Barre des Écrins zu klettern. Auf der Hütte rückte man enger zusammen, der Rotwein floß in Strömen. Für den österreichischen Bergführer neben mir war es klar: "Der Hannibal, der ist doch übern Großen St. Bernhard 'rüber." Andere widersprachen: "Naa naa, übern Kleinen isser!" Franzosen mischten sich ein, plädierten für "ihren" Montgenévre bei Briançon. Ich resignierte und legte die Kopien meines Aufsatzes aus den Händen. Nicht daran zu denken, heute abend noch Klarheit über die genaue Route von Hannibals Alpenübergang zu gewinnen.
Zwei Wochen lang waren wir danach die Pässe abgefahren und abgelaufen, die seit den Antiken Berichten bei Polybios und Livius in der Diskussion sind und die Jakob Seibert in seinem Aufsatz "Der Alpenübergang Hannibals. Ein gelöstes Problem?" (Gymnasium 95 (1988) 21-73) übersichtlich zusammengefaßt hat. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, mit den Lateinschülern der 10. Klasse die Hannibalroute zu Fuß und by fair means zu wiederholen, ein "thematischer Landheimaufenthalt", wenn man so will.
Zehn Jahre lang, seit meiner Referendarzeit 1979, hatte ich diese Idee mit mir herumgetragen, in mir bewahrt, gehegt, wachsen lassen. Damals hatte mein Mentor, Vater, Freund und Vorbild in einem, mir rundheraus davon abgeraten: zu gefährlich, unkalkulierbare Risiken. In der Zwischenzeit war ich selbst viel gewandert, geklettert, hatte Kurse besucht, war mit Schulklassen ins Landheim nach Südtirol gegangen und hatte immer wieder den tiefen Eindruck erlebt, den diese in den Bergen verbrachten Tage auf die Jugendlichen gemacht hatten. Daraus waren ihnen Orientierungen entstanden, langjährige Freundschaften, der Mut zur Selbständigkeit. Erst jetzt, nach 8 Jahren an derselben Schule, hatte ich wieder eine Gruppe beisammen, mit der ich den Mut in mir fühlte, aufzubrechen.
Die Voraussetzungen von Seiten der Schule und der Schüler waren mit den wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu vermitteln: eine Woche Zeit; möglichst billig; physisch und psychisch von einer Gruppe bergunerfahrener Schüler/innen von 15-18 Jahren zu leisten; zudem sollte der Weg alpin interessant und landschaftlich reizvoll sein. All dies zusammengenommen, fiel meine Wahl auf den Col du Clapier, einen 2450m hohen Paß im Mont Cenis - Gebiet (Haute Maurienne/Savoie). Diesen Vorschlag unterbreitete ich den Schülern der 10. Klasse zu Beginn des Schuljahres für Ende Juni 1990; die Idee war, zunächst die antiken Texte zu lesen, zu vergleichen, die Problematik des Weges zu diskutieren und am Ende des Schuljahres die Reise als Frucht unserer unterrichtlichen Bemühungen zu ernten. Es kam anders: wie ein Blitz schlug der Name Hannibal ein, die Schüler drängten, nachdem sie die ersten Bilder vom Sommer gesehen hatten, auf baldmöglichsten Aufbruch, und auch mir schien eine Woche Ende September für diese hochalpine Wanderung vom Wetter her günstiger. Gesagt, getan. In nur vier Wochen war nun alles vorzubereiten:
- Genehmigung von der Schulleitung, die davon abhing, daß alle Nichtlateiner zur selben Zeit ein anderes Landheim unternahmen [Es wurde hier aber nach alpinem Wollen und Können aufgeteilt, nicht nach Sprache. A.S.]
- Finden von Kollegen, die zu deren Begleitung bereit waren
- viele Einzelgespräche und Informationen im Kollegium, geduldiges Werben für die Idee, die im Widerspruch stand zur Tendenz, außerunterrichtliche Veranstaltungen aufs Äußerste einzuschränken
- Elternabend mit Diavortrag
- Herstellung von Expeditionspostkarten mit den Unterschriften aller Teilnehmer zur Versendung aus dem Basislager
- Entwurf, Herstellung, Werbung, Finanzierung und Verkauf von T-Shirts mit dem Motto der Expedition und dem Elefantenmotiv
- Bilder der Expeditionsmannschaft vor dem Elefantengehege im Zoo
- Informationen über das Unternehmen an die Lokalzeitung RNZ und an verschiedene Schulen in Heidelberg und Mannheim
- Verfassen und vervielfältigen zahlreicher Info-Blätter zur Route, Historie, Ernährung, Ausrüstung, Bekleidung, alpinem Verhalten
- Anschreiben zahlreicher Personen und Institutionen im Bildungsbereich
- Beschaffung der alpinen Mindestausrüstung
- Trainingsmärsche mit Gepäck auf den Königstuhl
- Klärung der Ernährungsfrage; Einkäufe
- telefonische und briefliche Kontakte mit den französischen und italienischen Hütten
- Ermittlung und Bestellung der Zug- und Busverbindungen Heidelberg - Basel - Genf - Chambéry - Modane - Bramans sowie Susa - Torino - Milano - Chiasso - Basel - Heidelberg
- Lektüre der Liviustexte auf deutsch
Wir hatten uns zwar mit dem Slogan "Nihil nos impediet" immer wieder selbst Mut gemacht, trotzdem erschien es uns fast unglaublich, als wir am Montag, dem 25.9., frühmorgens um 3.19 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof abfuhren. Auf der von mehrfachem Umsteigen unterbrochenen Bahnfahrt dachte ich nach: lohnte sich der Aufwand eigentlich? Zwei Wochen Forschung vor Ort in den großen Ferien, vier Wochen detailreicher, dichtgepackter Vorbereitung, zweimal mehr als 12 Stunden Bahnfahrt für 5 Tage anstrengender Bergtouren mit schwerem Gepäck? Ich hatte einen kleinen Stein ins Wasser geworfen; nun hatten sich Wellen ausgebreitet, die nicht mehr zurückzuholen waren, die sich, im Gegenteil, verselbständigten. Ich hatte am Anfang nur die Idee gehabt, spielerisch - experimentell, und jetzt standen 22 Leute unten in Bramans, auf 1300m, vor ihnen ca. 60 km Bergpfade, 3500 Höhenmeter im Aufstieg, 4000m hinab, mit Rucksäcken, die zwischen 14 und 20 kg wogen. All diese Angaben kannten sie zwar aus meinen Informationen, Karten, Plänen, Höhenprofilen, aber sie hatten sie offenbar nicht verstanden: wären sie sonst mitgegangen? Hätten sie sich sonst, gewohnt, alles aus dem Weg geräumt zu bekommen, einer solchen Strapaze unterzogen? Nur wegen Hannibal? Nur wegen unseres Slogans?
Einmal dort angelangt, war alles vorgezeichnet. Die Hütten bildeten ersehnte Schlupfwinkel, in denen wir uns geborgen fühlten in der Wärme des Herdfeuers in der Küche, eingemummt in die Decken des Matratzenlagers, ganz auf uns selbst gestellt, denn um diese Jahreszeit gab es keinen Gardien mehr oben.
Von Bramans über Le Planey (1660m), das der Hannibalforscher Lavis - Trafford zu seinem Domizil gemacht hatte, nach Ambin in 2200m Höhe gelangt, verweilten wir einen Tag im hintersten Talschluß am allseitig von hohen Felswänden umgebenen Ambinsee.
Vorwitzige, Übermütige oder auch nur Lebensfrohe sprangen ins Eiswasser, andere umrundeten den See, dabei ein Gletschertor aus der Nähe betrachtend, mit ihren Händen abtastend, dritte legten als Zeichen ihrer Anwesenheit einen Kreis von Steinen ins Wasser des Sees zu einem natürlichen Kunstwerk oder einem künstlichen Werk mit natürlichen Elementen, der Natur unterworfen, zu ihrer zurückkehrend im Laufe der Jahreszeiten, in den Jahren der Erosion; mit anderen stieg ich auf den Col d'Ambin (2800m), um nach Italien auf der anderen Seite hinabzuschauen, immer beobachtet vom grünen Auge des Sees, an dessen Felssaum wir unvorstellbar kleine Menschen zurückgelassen hatten.
Während sich da oben jeder eine Weile von seinen Gefühlen forttreiben ließ, flogen in Minutenschnelle Wolken zu uns herauf, keiner wußte zu sagen, woher, plötzlich schien die ganze Umgebung verändert, war verändert: erst jetzt erkannten wir den Schnee auf den Platten, über die wir heraufgestigen waren. Manch einer wurde unsicher, drängte zum Aufbruch. Weiter unten, an einem zugefrorenen See, trennten wir uns: während die einen zur Geborgenheit der Gruppe da unten am See, der jetzt plötzlich wieder in der Sonne lag, zurückflohen, stiegen wir, zu dritt nur noch, durch eine braungrasige Flanke auf den trümmerübersähten Grat der Pointe d'Ambin und über diesen in leichter Kletterei auf den Gipfel, 3260m. Wie schön leuchtete der verhaltene Stolz aus den Augen dessen, der heute seinen ersten Dreitausender bestiegen hatte, mit noch nicht 16 Jahren. Ich beneide ihn, bei mir hatte es über 20 Jahre gedauert, und ich war auch ein wenig neidisch auf diese Frische des Erlebens, dieser erwachenden Liebe zu den Bergen, dieses fast überraschten Stolzes auf seine eigene Tat.
Der entscheidende Tag unserer Alpenüberquerung war Donnerstag, der 28.9. Zu nächst stiegen wir von Ambin, wo wir uns zwei Tage lang akklimatisiert hatten, zurück nach Le Planey, wo wir den Müllsack deponierten, den wir aus der Höhe mit hinuntergenommen hatten, getreu unserer Devise, den Berg so zu verlassen, wie wir ihn angetroffen hatten. Von Le Planey hieß es dann, 550 Höhenmeterdurch in herbstlichen Farben glühende Blumen und Büsche hinaufzusteigen auf den Col du Petit Mont Cenis (2200m). Nach einer längeren Rast führte uns dann in mäßiger Steigung der Weg entlang des Savine-Baches im Schutz hoher, sonnendurchglühter Bergflanken zum Lac de Savine, eine Virtelstunde vor der Paßhöhe des Col du Clapier (2450m). Während die Wolken und die Sonne hoch über uns sich ein Spiel daraus machten, die Umrisse der Berggipfel, riesig vergrößert, als Schatten an den Himmel zu projizieren, pfiff hier unten am See ein erbarmungsloser Wind, der uns in kürzester Zeit vollständig ausgekühlt hätte, würde ich hier, wie geplant, Hannibals Ansprache an seine erschöpften Soldaten aus dem Livius vorgelesen haben. Und das anstrengendste Stück Weges lag ja noch vor uns: die 500 Höhenmeter hinauf Wasserscheide des Passo Trinceramenti in 2890m. Sonne und Wind hielten sich während dieses Aufstiegs am späten Nachmittag die Waage, und Visionen - oder sollte ich sagen: die Fata Morgana? - von riesigen Spaghettiportionen, Rotwein, warmen Lagern zogen uns die steilen Wegspuren hinauf. Auf der anderen Seite des Passes, schon im düsteren Schatten, triste Spuren des 2. Weltkrieges: rostige Stacheldrähte, offengelassene, jetzt zerbröckelnde Befestigungen, verschissene Kasernen, durch deren Dächer Nebelfetzen hereinschauten, verfallende, oft nur noch zu erratende Militärwege. Auch hier noch nach 9 Stunden Marsches, galt es die Konzentration aufrechtzuerhalten: ein rasches Umknicken des Fußes, ein losgetretener Stein konnten fatale Folgen haben!
Endlich die Hütte, 400m tiefer, schon im Abendschatten verschwindend. Während wir vorsichtig weitergehen, wundern wir uns: kein Licht. Wahrscheinlich sind die Läden geschlossen. Fast schon unten angelangt, schreien uns die er sten entgegen: die Hütte ist zu! Ich kann es nicht glauben! Zweimal hatte ich mit den gestori telefoniert, für zwei Nächte Lager und Essen vorbestellt, man hatte mir zugesichert, jemand werde heraufkommen! Und jetzt, wenige Minuten vor 19 Uhr, fast stockdunkel ist es geworden, ist die Hütte so fugen los dicht, wie ich noch keine gesehen habe. Keine Chance, etwa durch ein Fenster einzubrechen. Ein einziger kleiner Raum, il riparo, steht offen: mit einem Tisch, 2 Bänken, 3 nackten Holzpritschen, einem Ofen, der wie wir sehr bald merken werden, nicht funktioniert, vor allem aber: keine Matratzen, keine einzige Decke! Handeln. Ich bin furchtbar gespannt, schreie herum: im letzten Abenddämmern sofort die Rucksäcke an die Wand neben der Außentür, damit man sie auch im Dunklen findet; alles anziehen, was man hat, sofort, nicht erst herumstehen, bis einen friert. Manche pochen auf ihr Recht auf eine Pause nach einem ganzen Tag Gehen, ich bleibe unerbittlich, für eine Weile ist die Si tuation zum Zerreißen gespannt: da finden Nelson und Carla, die beiden Südamerikanischen Stipendiaten, die ich als Begleitpersonen mitgenommen habe, die lösenden Worte. Zwei versuchen Feuer zu machen, es raucht und treibt un s die Tränen in die Augen und erlischt Gott sei Dank wieder. Andere holen W asser, die mitgeführten Campingkocher leuchten auf, und werden die meiste Z eit der Nacht nicht wieder erlöschen. Die Sechs mit Schlafsäcken organ isieren sich selbst in einem eingestürzten Nebengebäude, die anderen 16 müssen in dem riparo von vielleicht 9 m² Platz finden. Die Nacht ist lang, fast unendlich; die Rucksäcke, die über Nacht draußen gestanden hatten, sind am Morgen über und über mit Reif bedeckt. Obwohl die Sonne schon früh strahlt, wärmt sie nicht, und wir bleiben noch lange liegen. Niemand hat einen Schaden davongetragen. Ich bewundere die Beiläufigkeit, mit der sie diese völlig unerwartete Situation wegstecken. Ihr Mütchen, ihre Frustration kühlen sie an martialischen Strafen, die sie einem imaginären Hüttenwirt namens Toni angedeihen lassen wollen, wenn sie ihn in Susa auf der Straße träfen. Während sie sich in ihrem Erfindunsreichtum gegenseitig überbieten, gehe ich hinaus in diesen strahlendkalten Morgen, um zu fotografieren. In der Ferne erkenne ich die gewaltigen Umrisse des Monviso (3841m); erst sechs Wochen ist es her, daß ich, an einem ebensolchen Morgen, in unermeßliche Ferne blickend, mich davon überwältigt gefühlt hatte, von diesem Kontrast zwischen mir, dem winzigen Punkt, und diesen fernen Unendlichkeiten, und um die in mir aufsteigenden Tränen zu unterdrücken, ins Gipfelbuch die Worte Salvatore Quasimodos geschrieben hatte, die einzigen passenden, wie mir schien: "Ognuno sta solo sul cuor della terra traffitio da un raggio di sole: ed é subito sera." ("Jeder steht allein auf dem Herzen der Erde durchbohrt von einem Sonnenstrahl: und sofort ist es Abend.") Während mir so die Vergangenheit und die Gegenwart in eins fließen, läßt ein Schrei die Luft erzittern, ein kraftvolles Brüllen, und als sei ein Tarzan der Berge herniedergefahren, umkreist Tobias in gewaltigen Sprüngen die Hütte: er braucht ein Ventil für seine Kraft und Lebensfreude; sein wilder Tanz erinnert mich an Peer Gynts Ritt auf dem Bock über den Jendegrat.
Ich disponiere um: einen weiteren Tag in der Höhe hatte ich vorgesehen gehabt, um auf dem Clapierpaß Livius vorzulesen, um ein paar Steinmänner zu bauen, vielleicht einen Berg noch zu besteigen, den Agnellogletscher, seine Moräne und den kleinen Moränensee zu besuchen und über die unglaublichen Formen, Muster und Rhythmen der Natur dort zu staunen oder auch, um einfach dort oben zu sein, absichtslos, unbedrängt durch Zwecke und Ziele. Jetzt aber geht es nur noch hinab nach Susa, denn eine zweite Nacht unter diesen Umständen will ich ihrem noch jungen Bergenthusiasmus ersparen. 2200 Höhenmeter hinab, 18 km. Im Dunst des Flußtals der Dora Riparia erkennt man Susa schon bald, kann aber noch nichts genaues ausmachen. Zur Rechten haben wir lange die steilen Serpentinen des Abstiegs vom Clapier, das in Generationen dem Berg eingeprägte Zickzackband, während von unserem Weg steile Rippen ins Tal abfallen, auf deren Kämmen wir immer andere Formen erkennen, einmal sogar den Rüssel eines Elefanten. Während des langen Abstiegs wiederholen sich die Phasen des Vortages: es ist anstrengend; man klagt; man beschwert sich; man verliert die Lust; man kann nicht mehr; man geht weiter; man kommt an; man sagt nichts mehr; man ist erstaunt und stolz; dann bricht in wildem Wortgeschnatter die so ertragene Spannung sich Bahn.
In Susa finden wir uns abends zu einem brindisi im Hotel gegenüber der stazione zusammen, frisch geduscht, zum ersten mal seit einer Woche. Mit Asti Spumante stoßen wir auf unser Unternehmen an. Ich versichere ihnen, sie seien die Ersten in 8 Jahren an der Schule, mit denen ein solches Projekt möglich gewesen wäre; ihr Enthusiasmus, ihr Zusammenhalt, ihre Initiative, ihr Erfindungsreichtum, ihre Frustrationstoleranz, ihr Humor hätten sie über alles hinausgetragen, was sie bisher erlebt, was sie bisher für möglich gehalten hätten. Und ich sehe in ihren Augen das Erstaunen über sich selbst, über ihre ihnen selbst bisher verborgen gewesenen Möglichkeiten, Kräfte, Energien.
Der vorzeitige Abstieg schenkt uns einen vollen Tag im sonnigen Turin. Wir
steigen auf die Mole Antonelliana, das Wahrzeichen der Stadt, die
Häuser, Parks und Palazzi 85m tiefer zu unseren Füßen, die
Berge im Dunst verschwunden. Plötzlich erscheint mir alles wie
ausgelöscht. Ich trage noch meine Alpinsachen, am Bahnhof steht mein
Rucksack. Trotzdem muß ich mich ernsthaft besinnen: waren wir wirklich
da oben? Es ist wie ein Rausch gewesen. Die Rückfahrt über Mailand
zieht sich lang hin. Im Zug treffen wir eine Gruppe Heidelberger
Schüler eines andren Gymnasiums; sie waren in Rom gewesen, sind
glücklich über diese Tage, sprudeln über, ihre Augen leuchten
noch, manche rauchen. Ihre Lehrer laufen durch den Gang, rufen sich etwas
zu, nennen sich Herr und tragen helle Anzüge. Etwas hält mich
davon ab, sie anzusprechen. Ist es meine alte, zerschlissene Bergkleidung?
Bin ich in Gedanken und Gefühlen noch nicht von dort oben
herabgestiegen? In diesem Moment fühle ich mich wie aus Glas, ganz
prekär, es ist dasselbe Gefühl wie auf dem Gipfel des Monviso. Ein
Traum hat sich realisiert, ein Traum, der 10 Jahre in mir gelebt hatte, und
er hat in mir eine bestürtzende, erschreckende Leere hinterlassen.
Plötzlich gibt es nichts mehr zu erzählen, zu reden, auch wenn am
Montag jeder wissen will, wie es war. Ich finde keine Worte für alles,
was in dieser Woche mit uns vorgegangen ist, Formeln allenfalls,
Hülsen, die mich vor diesen Fragen schützen. Ich merke, wie wenig
diese Unternehmung übertragbar ist, Modell sein kann, Ideologie
befördern kann. Am genauesten kann ich es nur auf griechisch
ausdrücken: 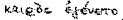 .
Der richtige Augenblick war da; wir haben ihn erkannt, wir haben ihn
für uns genutzt.
.
Der richtige Augenblick war da; wir haben ihn erkannt, wir haben ihn
für uns genutzt.
Erst Später, als ich diese Zeilen schreibe, kommt mir zu Bewußtsein, wie tiefreichend die Analogie ist, die zwischen unserer Beschäftigung mit den antiken Texten im Unterricht und unserem Unterwegssein im Gebirge in dieser Woche besteht. Natur in der Form wilder Landschaften konfrontiert uns, entlockt uns unsere Fähigkeiten und Begrenztheiten; sie ist nicht vorhersagbar, nicht beeinflußbar, nicht gut, nicht böse, objektiver und unbestechlicher Spiegel dessen, was wir gegenwärtig sind, Katalysator für unser Menschsein in einer ansonsten bis zum überdruß gemachten, hergestellten Welt. In den unverfälschten, unverfügbaren, unnützen Landschaften sind eindeutige Erfahrungen möglich. Und dieselben Kriterien des Unnützen, nicht Instrumentalisierbaren, Entfernten, darum Objektiven gelten ja für die antiken Texte. Unnötig für den oberflächlichen Lauf der Dinge, unzugänglich dem Modernen, werden sie unumgänglich und zur Notwendigkeit erst dem, der an sich selbst heranwill; erst dem Reflektierenden werfen sie ein Bild seiner selbst zurück, seinen Standort, sein Maß. Das Gebirge, die wilden Landschaften, die antiken Texte offenzuhalten als Feld der Selbsterfahrung, Selbstbestimmung, das habe ich an dieser Reise erfahren, darum geht es mir.
Michael Stimpel

